Im Saarland sind Reformen der Landkreise und Gemeinden unumgänglich. Sie werden aber blockiert, auch weil die Kommunalelite vom bisherigen System durch hohe Nebeneinkünfte profitiert. An Veränderungen hat sie kein Interesse.
Ca. 120 bis 140 kommunale Unternehmen, Betriebe, Zweckverbände, Stiftungen und Sparkassen leisten ihren Anteil an der Daseinsvorsorge für die saarländischen Bürger. Die hohe Zahl der kommunalen Gesellschaften ist eine Folge der kleinteiligen Organisation des Kommunalbereichs in sechs Landkreise und 52 Gemeinden. Rechtlich und wirtschaftlich beaufsichtigt werden sie von einigen hundert Kommunalpolitikern. Diese organisiseren sich in lukrativen lokalen Netzwerken .

Auch das Saarland-Logo bildet das Land als Netzwerk vieler lokaler Machtzirkel ab.
Beispiel Saarbrücken: 63 Stadtverordnete haben 500 Aufsichtsposten inne
Die Landeshauptstadt Saarbrücken betreibt 78 Unternehmen und Eigenbetriebe und ist an Zweckverbänden beteiligt. Die Stadt hat hier rund 500 Aufsichtsposten an die 63 Stadtverordneten zu vergeben. Im Schnitt sitzt also jedes Stadtratsmitglied in acht Organisationen (Beteiligungsbericht der Landeshauptstadt Saarbrücken 2022). Ihre Vergütung liegt bei kleinen bis mittleren Unternehmen bei etwa 400 bis 2.000 Euro pro Sitz, bei den Sparkassen deutlich darüber. In den anderen Saar-Städten dürften die kommunalwirtschaftlichen Aktivitäten ähnlich sein.
Beispiel Neunkirchen: Der Landrat persönlich kontrolliert 24 Gesellschaften
Auch in den Landkreisen haben die Parteien ihre Claims abgesteckt. Im Kreis Neunkirchen beispielsweise haben 33 Kreistagsmitglieder 70 Aufsichtsfunktionen in 24 Gesellschaften und Verbänden. Am aktivsten engagiert sich der Landrat selbst. Sören Meng hat die Kontrolle in 24 Gesellschaften des Kreises, u.a. in vier Gremien des Sparkassensektors, in jeweils vier Gesellschaften des Nahverkehrs, der Energie- und Wasserversorgung und in mehreren GmbHs (Beteiligungsbericht des Kreises Neunkirchen).
Kommunalpolitiker: Wenn’s ums Geld geht – Sparkasse
Von den 108 Verwaltungsratssitzen, die bei den sechs Sparkassen die Geschäftspolitik überwachen, vergeben die Parteien 36 Sitze an Kommunalpolitiker. Diese bekommen dafür – abhängig von der Bilanzsumme – im Durchschnitt zwischen etwa 4.000 Euro (Merzig-Wadern und Homburg) und 8.000 Euro (Saarbrücken) pro Jahr. Den Vorsitz stellen die Landräte, teils im Wechsel mit Oberbürgermeistern. Sie verdienen mehr als das Doppelte des Normalsatzes, die Stellvertreter etwas weniger.
Nebeneinkünfte von 40-50.000 Euro
Für den Neunkircher Landrat Sören Meng fließen vom Verwaltungsrat der Sparkasse Neunkirchen 13.125 Euro, vom Sparkassenverband Saar 6.200 Euro, vom Sparkassenbeirat der Saar LB 6.200 Euro und von der Sparkassenakademie noch 1.800 Euro. Insgesamt Nebeneinnahmen von jährlich 27.000 Euro allein aus dem Sparkassen-Sektor, nicht abführungspflichtig (Angabe des Landkreises nach Saarlandinside-Anfrage). Hinzukommen etwa 13.000 Euro von der VSE. Noch mehr streichen die Landräte Udo Recktenwald (CDU, St. Wendel), Patrick Lauer (SPD, Saarlouis) und Regionalratspräsidentin Dr. Caroline Lehberger (SPD, Saarbrücken) ein. Die Merziger Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich (CDU) sitzt zudem neben den Ministern Jakob von Weizsäcker (SPD) und Jürgen Barke (SPD) und dessen Staatssekretärin Elena Yorgova-Ramanauskas (SPD) im Verwaltungsrat der Saar Landesbank. Diese zahlt an die zwölf Mitglieder laut Geschäftsbericht 225.000 Euro an Tantiemen (Geschäftsbericht). Geschätztes Zubrot für die Politiker: ca. 15.000 Euro.
Kommunalpolitiker haben Einfluss auf Kreditvergaben
Die Verwaltungsräte der Sparkassen greifen auch ins Bankengeschäft ein. Sie können laut Sparkassengesetz dem Kreditausschuss ihres Hauses auch Geschäftsanweisungen erteilen. Die Umstände um manche umstrittene Großprojekte der Kassen, u.a. das St. Wendeler Missionshaus-Areal mit Beteiligung der Sparkasse St. Wendel, wären in diesem Kontext zu hinterfragen.
Kredite für Kommunalpolitiker zu Top-Konditionen
Noch ein finanzieller Vorteil für die Sparkassenaufseher: Sie holen sich quasi im eigenen Haus Kredite zu Top-Konditionen, im Schnitt 100.000 Euro. Die Sparkassen müssen diese in ihren Geschäftsberichten angeben. Unter Kommunalpolitikern spricht man von Zinssätzen von etwa einem Prozent. Das sind Vorteile aus dem kommunalpolitischen Ehrenamt, die man gerne annimmt. Am liebsten unter Ausschluss der Öffentlichkeit: Um die Profiteure nicht in die Bredouille zu bringen, haben einige Saar-Sparkassen inzwischen die Namensliste der Verwaltungsräte auf ihren Webseiten gelöscht.
Landräte mit beachtlichem Zubrot bei der VSE
Weitere Fleischtöpfe der Kommunalwirtschaft stehen in den Versorgungsunternehmen. Beispiel VSE: Im dortigen Aufsichtsrat haben sich der Saarbrücker OB Uwe Conradt, die Bürgermeister aus St. Wendel, Peter Klär, und Bous, Stefan Louis, die Landräte Udo Recktenwald (St. Wendel), Sören Meng, Patrick Lauer (Saarlouis) und die Regionalverbandspräsidentin Carolin Lehberger neben Wirtschaftsminister Barke (SPD) festgesetzt. Insgesamt schüttet die VSE laut Geschäftsbericht 270.000 Euro an Vergütungen an 21 Mitglieder aus, im Schnitt etwa 13.000 Euro. Genau Zahlen nennt die VSE auf Saarlandinside-Anfrage nicht.
Landräte sind – der Bedeutung und Belastung des Amtes angemessen – mit bis zu 130.000 Euro im Jahr besoldet. Durch die Nebentätigkeiten bekommen sie 40-50.000 Euro obendrauf. Wie ein Landrat den Zeitaufwand für 24 Aufsichtsgremien in der Vollzeit-Aufgabe Landrat unterbringen will, ist eine andere Frage. Zur Einordnung: Die Nebeneinkünfte sind fast so hoch wie das Jahresgehalt eines Bauingenieurs mit Bachelorabschluss in seiner Kreisverwaltung.
Kommunalpolitiker sollen das medizinische Geschäft kontrollieren
Auch die Aufsichtsgremien der kommunalen Krankenhäuser sind in Parteienhand. Im Klinikum Saarbrücken beispielsweise, Umsatz 180 Millionen Euro, sind 13 von 16 Aufsichtsräten von den Stadtratsparteien entsandt. Im Kreiskrankenhaus St. Ingbert, Umsatz 45 Millionen Euro, kontrollieren 13 von insgesamt 14 Kreistagsmitgliedern das medizinische Geschäft und bestimmen die Krankenhaus-Politik.
Die Aufseher sind häufig Laien
Die Verwaltungs- und Aufsichtsratsmitglieder sollen ihre Expertise einbringen, um Risiken zu minimieren und Chancen für das Unternehmen zu nutzen. Das Fachwissen dafür ist nicht bei allen Akteuren auf Anhieb erkennbar. Lehrer, Hausfrau, Fotograf, Verkäuferin, Student, Rentner, Regierungsangestellter – eine Auswahl aus den Mitgliederlisten – sind zwar allesamt honorige Berufe. Für die Qualifikation als Aufseher von Banken mit einer Bilanzsumme von mehr als acht Milliarden Euro oder von Energie- und ÖPNV-Unternehmen dürfte dies nicht ausreichen. Nebenbei: Stadt- und Gemeinderats-, Kreistagsmitglieder, Landräte, Bürgermeister oder Ortsvorsteher in die Aufsichts- und Verwaltungsräte zu schicken, ist kein gesetzlicher Zwang. Der Landkreis könnte auch Fachleute von außen ernennen.
Aufsichtsratssitze als Lohn der Partei
Je höher der Rang in der Partei, je aktiver der Einsatz für sie, desto eher kann ein Politiker mit lukrativen Sitzen rechnen. Umgekehrt gilt auch: Wer in der Partei nicht auf Stromlinie fährt, hat geringere Chancen auf einen Nebenjob. Die Vergabe von Aufsichtsratsmandaten wird so zum Element im Belohnungssystem für Parteimitglieder.
70 Prozent der MdL sitzen auch in Kommunalparlamenten
Bei der Steuerung der lokalen Machtgeflechte mischen auch Landespolitiker kräftig mit. So sind 37 der 52 Landtagsabgeordneten, das sind 70 Prozent, im Nebenjobs noch Orts-, Gemeinde- oder Kreisräte. Sie freuen sich auch über Nebeneinkünfte von Sitze in Sparkassen, Energieversorgern, Krankenhäusern, Energie- und Wasserversorgern und Verkehrsbetrieben (saar-landtag.de).
Die „Gier nach Zuständigkeiten und Macht“
Solcherlei maßlose Begehrlichkeiten haben es inzwischen in die saarländische Belletristik geschafft. Der Saarbrücker Historiker Dr. Wolfgang Bach greift sie in seinem Roman “Ins zierliche Land” auf. Bach erzählt vom Wandel in Politik, Gesellschaft und Kultur, betrachtet die Akteure, ihre Werte und Beweggründe kritisch. In einer Episode beklagt ein Stratege auf einer Landesvorstandssitzung der Partei einige Missstände der Politik:
Dann die Krankheit des “Aufhäufens”, von der können sich auch die unter uns anstecken lassen, die ihre zwar berechtigten Diäten, aber zu üppige Aufsichtsratsvergütungen summieren…Die Krankheit des Aufhäufens kann sich auch als Gier nach Zuständigkeiten und Macht herausstellen…
NVG Neunkirchen: Wenn der moralische Kompass verloren geht
So entstehen unter Beteiligung von Landespolitikern lokale Netzwerke und Abhängigkeiten. Sie spielen im „Land der kurzen Wege“ eine bestechend einflussreiche Rolle. Die aktuell ans Licht gekommenen Schmuddeleien um die hochdefizitäre Neunkircher Verkehrsgesellschaft (NVG) sind keine Kleinigkeit: Betriebsausflüge städtischer Ämter, kostenlose Busfahrten für Spezis und Fahrten von SPD-Oberbürgermeister Jörg Aumann auf Kosten des Steuerzahlers mit zwei Chauffeuren als Privatmann zum Parteitag der SPD in Berlin. Jobs bei der NVG sollen vorrangig SPD-Mitglieder erhalten haben. Der NVG-Aufsichtsrat hat es sogar geschafft, Aumann seinen zwischenzeitlich entzogenen Posten des Vorsitzenden zurückzugeben. Damit könnte Aumann die Aufarbeitung des Skandals, bei dem er selbst im Mittelpunkt steht, beeinflussen. So macht sich der Bock selbst zum Gärtner.
„Ich kenne eene, der kennt eene…“
So lautet das saarländische Glaubensbekenntnis zum Ergattern von Vorteilen jedweder Art. Dieses Prinzip funktioniert in Freundschaftsnetzwerken und im Zusammenspiel zwischen Kommunalpolitik und Kommunalverwaltung bestens. Zum Beispiel bei der Vergabe von heißbegehrten Grundstücken der Stadt Saarbrücken im Neubaugebiet „Franzenbrunnen“. Eine SPD-Landespolitikerin soll laut Medienberichten drei bestplatzierte Grundstücke noch vor der offiziellen Verlosung unter der Hand bekommen haben, so der Verdacht. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Blick ins Wohngebiet Franzenbrunnen © Tom Gundelwein
Wenn lokale Parteiinteressen dem Steuerzahler schaden
Wenn lokale Gefahr aufzieht, stützt auch die Landesregierung schon mal die örtlichen Machtzirkel. Wie im Fall des Homburger Ex-Oberbürgermeisters Rüdiger Schneidewind (vormals SPD). Der war in seiner Detektivaffäre wegen Untreue zu 10.000 Euro Strafe verurteilt worden. Ein Disziplinarverfahren hätte sich anschließen müssen. Innenminister Reinhold Jost (SPD) hatte damit aber so lange gewartet, bis Schneidewind, inzwischen pensioniert, nicht mehr zu belangen war. Die Folge: Schneidewind bekam115.000 Euro Gehaltsnachzahlung.
Fazit: Mal abgesehen von den aufgeflogenen Mauscheleien in Neunkirchen und anderswo – die kommunalpolitische Elite profitiert durch beträchtliche Nebeneinkommen in der Wirtschaft. Durch die dringend notwendigen Strukturreformen, zum Beispiel eine Zusammenlegung der Landkreise, müssten sie ihre Privilegien aufgeben. Das dürfte schwierig werden. Was wir brauchen, sind Politiker, die das Allgemeinwohl über den Eigennutz stellen.
Lesen Sie in Kürze: Die Fusion der Landkreise wäre ein Modernisierungsschub für das Saarland
Quellen:
Geschäftsberichte der Saar-Sparkassen und der Saar LB
Geschäftsberichte von kommunalen Gesellschaften
Beteiligungsberichte der Landkreise und der Stadt Saarbrücken
Haushalt des Landkreises Neunkirchen
Wolfgang Bach: Ins zierliche Land (2024) Geistkirch-Verlag, 19,80 Euro.
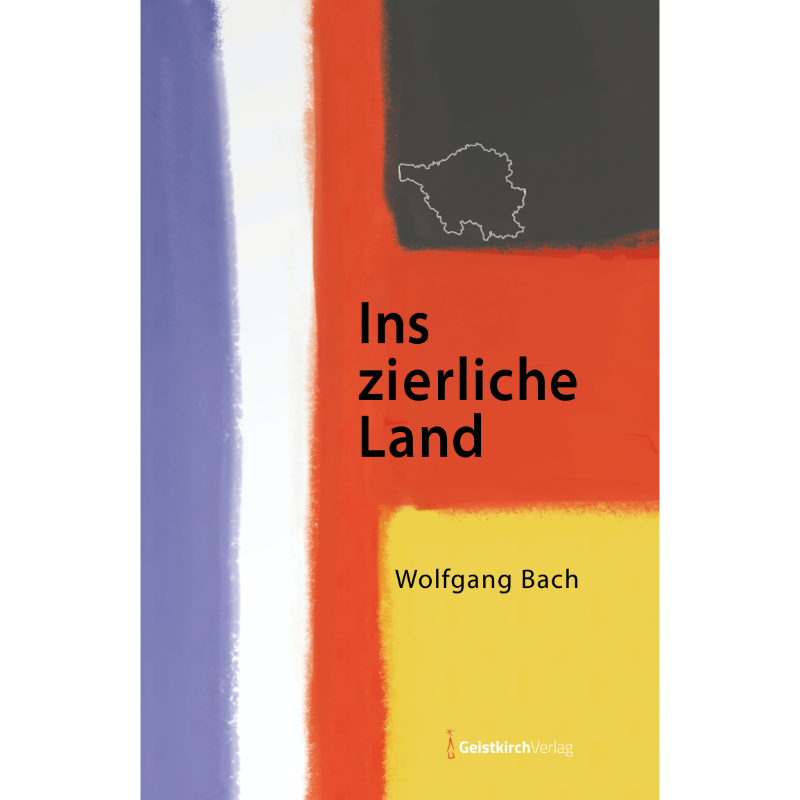
Artikel ergänzt am 31.11.2025

